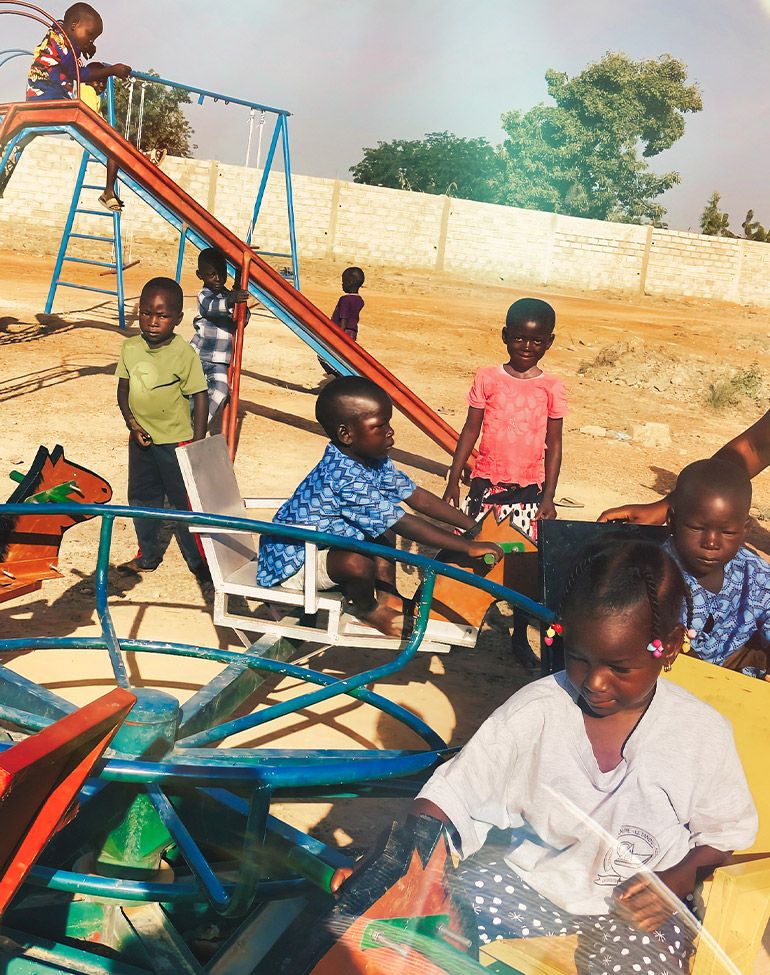Gemeinde Buttenwiesen
Besonders. Vielseitig an der Zusam.
News

Einbau von Mittelinseln im Zuge der Kreisstraße DLG 3

Aktualisierung der Bauantragsformulare und weiterer baurechtlicher Vordrucke zum 01.03.2024

Bewerbung zum Briefwahlhelfer

Ausbau der Ortsdurchfahrt Buttenwiesen

Nächste Rattenbekämpfung am 10.05.2024 – Bekanntmachung

Sauna im Freibad Lauterbach – Terminreservierung

Veranstaltungen Lernort Buttenwiesen
Buttenwiesen. Aktuell.
Veranstaltungen für 1 April
Veranstaltungen für 2 April
Veranstaltungen für 3 April
Veranstaltungen für 4 April
Veranstaltungen für 5 April
Veranstaltungen für 6 April
Veranstaltungen für 7 April
Veranstaltungen für 8 April
Veranstaltungen für 9 April
Veranstaltungen für 10 April
Veranstaltungen für 11 April
Veranstaltungen für 12 April
Veranstaltungen für 13 April
Veranstaltungen für 14 April
Veranstaltungen für 15 April
Veranstaltungen für 16 April
Veranstaltungen für 17 April
Veranstaltungen für 18 April
Veranstaltungen für 19 April
nichtöffentliche Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Unterthürheim
Veranstaltungen für 20 April
Veranstaltungen für 21 April
Veranstaltungen für 22 April
Veranstaltungen für 23 April
Veranstaltungen für 24 April
Veranstaltungen für 25 April
Veranstaltungen für 26 April
Veranstaltungen für 28 April
Veranstaltungen für 29 April
Veranstaltungen für 30 April
Veranstaltungen für 1 Mai
Anfischen an der Zusam
Veranstaltungen für 2 Mai
Treffen im Dorfladen Lauterbach
Veranstaltungen für 3 Mai
Proklamation der Schützenkönige
Veranstaltungen für 4 Mai
Fußball Kinder-Aktionstag
Veranstaltungen für 5 Mai
Anfischen am Weiher im Stadelfeld
Wöchentliche Termine aus dem Rathausbrief finden sie hier

Besonders. Lebenswert an der Zusam.
Im wunderschönen Donauried
Im wunderschönen Donauried mit seiner einmaligen Natur gelegen, gut an die umliegenden Städte angebunden, charmant und doch modern, familienfreundlich und mit allem ausgestattet, was man zum Wohlfühlen braucht: Das ist Buttenwiesen mit seinen Gemeinden. Herzlich Willkommen!

Ein reiches Erbe
370 Jahre jüdisches Leben in Buttenwiesen
In den 370 Jahren, in denen Jüdinnen und Juden in Buttenwiesen lebten, haben sie den Ort stark geprägt. Noch heute kann man hier die Spuren jüdischen Lebens entdecken. Dass diese erhalten bleiben und auch weiterhin an die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger von damals gedacht wird, ist der Gemeinde ein großes Anliegen.

Bildung für Afrika
Buttenwiesen erweitert eine Schule
Bildung ist die Grundlage für ein gelingendes, selbstbestimmtes Leben – rund um die Welt. Davon ist auch die Gemeinde Buttenwiesen überzeugt und hat sich deshalb im Jahr 2019 mit einem groß angelegten Spendenprojekt für den Ausbau einer Schule in Burkina Faso engagiert.